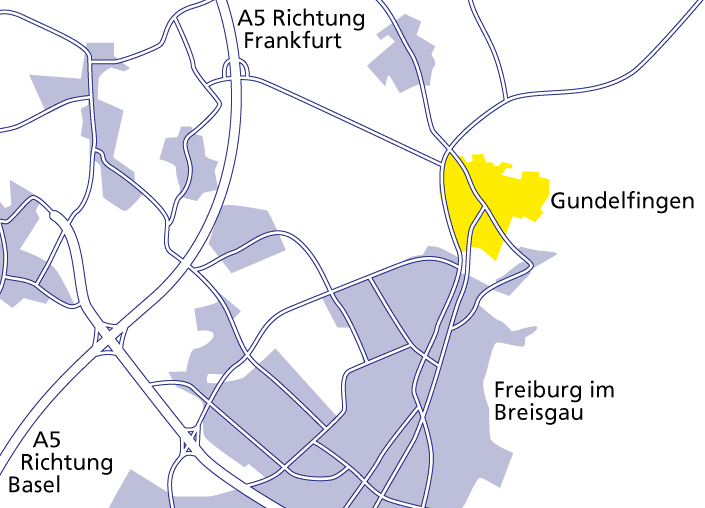Bandscheibenprothese

- Was ist eine Bandscheibenprothese?
- Wann kommt eine Bandscheibenprothese in Frage?
- Welche Typen von Bandscheibenprothesen gibt es?
- Einsatz einer Bandscheibenprothese
- Wie sind die Erfolgschancen beim Einpflanzen einer Bandscheibenprothese?
Was ist eine Bandscheibenprothese?
Bei einer Bandscheibenprothese handelt es sich um eine künstliche Bandscheibe, die eine verschlissene oder verletzte Bandscheibe ersetzen soll. Es gibt verschiedene Arten von Bandscheibenprothesen. Die jeweilige Auswahl erfolgt danach, in welchem Bereich der Wirbelsäule die Prothese eingesetzt werden soll und welche Funktion benötigt wird.
Wann kommt eine Bandscheibenprothese in Frage?
Eine Bandscheibenprothese wird bei verschiedenen Krankheitsbildern der Wirbelsäule dann erwogen, wenn konservative oder interventionelle Verfahren keine Linderung der Beschwerden bringen. Häufige Indikationen an der Halswirbelsäule sind
- einzelne Bandscheibenvorfälle, die sich weder endoskopisch noch minimal-invasiv chirurgisch behandeln lassen,
- zervikale Myelopathie oder
- Stenose der Zwischenwirbellöcher mit Radikulopathie.
An der Lendenwirbelsäule (LWS) kommen Bandscheibenprothesen nur äußerst selten zum Einsatz. Das liegt u.a. daran, dass die LWS einer besonders hohen Belastung ausgesetzt ist. Zudem ist der Eingriff sehr viel aufwendiger als an der HWS und mit deutlich mehr Risiken belastet. Manche Wirbelsäulenchirurgen erwägen eine LWS-Bandscheibenprothese bei schwerer Osteochondrose im Bereich der unteren LWS-Segmente.
Für den Einsatz einer künstlichen Bandscheibe muss der Patient verschiedene Voraussetzungen mitbringen. Sie werden bei der klinischen Untersuchung und mithilfe der Bildgebung überprüft. Dazu gehören im Wesentlichen:
- eine gesunde Knochensubstanz (keine Osteoporose),
- nur wenig ausgeprägte degenerative Veränderungen der benachbarten Wirbelkörper,
- bewegliche Wirbelkörper im betroffenen Segment,
- intakte Facettengelenke, intakte Bandstrukturen und
- eine Mindesthöhe des Zwischenwirbelraums der degenerierten Bandscheibe von mindestens 3 mm.
Welche Typen von Bandscheibenprothesen gibt es?
Ganz allgemein werden Bandscheibenprothesen nach ihrem Aufbau und ihrer Lokalisation unterteilt. Prothesen für die HWS sind z. B. kleiner und beweglicher als Prothesen für die LWS. Oft bestehen die Prothesen aus zwei Platten, zwischen denen ein sogenannter Kern liegt. Das Design der Produkte wird kontinuierlich weiterentwickelt, um Form und Funktion immer besser an die Bedürfnisse der Patienten anzupassen.
Häufig kommen Metall-Kunststoff-Prothesen zum Einsatz. Typisch sind Endplatten aus Titan oder Cobalt-Chrom-Molybdän mit Kernen aus Polyethylen, Polyurethan oder Polycarbonurethan. Teilgekoppelte Prothesen haben ein fixiertes Rotationszentrum und sind eingeschränkt beweglich, dafür aber stabiler. Ein ungekoppelter, frei beweglicher Kern ermöglicht dagegen Bewegungen in allen Ebenen.
Einsatz einer Bandscheibenprothese
Das Einpflanzen einer Bandscheibenprothese erfolgt in Vollnarkose und unter Beatmung. Zunächst entfernt der Chirurg die alte Bandscheibe. Mithilfe von Probeimplantaten ermittelt er die richtige Größe. Danach pflanzt er die passende Prothese ein und prüft deren Sitz unter Durchleuchtung. Ist alles korrekt, wird die Wunde gespült und verschlossen.
Nachbehandlung nach Bandscheibenersatz
Meist ist am OP-Tag schon wieder ein selbstständiges Gehen möglich. Bei problemloser Wundheilung kann der Patient nach zwei bis fünf wieder nach Hause. Vorher wird mittels Röntgen kontrolliert, ob die Prothese gut sitzt. Bei einer HWS-Bandscheibenprothese ist in der Regel keine Orthese (Halskrause) nötig. Wurde die LWS operiert, muss über ca. sechs Wochen ein Stützkorsett getragen werden.
Sechs Wochen nach OP sollen das Heben und Tragen von Lasten über 10 kg vermieden werden. Ab der sechsten Woche beginnt die Krankengymnastik, insbesondere ein Aufbau der Stützmuskulatur. Nach drei Monaten wird das korrekte Einwachsen der Prothese röntgenologisch kontrolliert. Ist alles in Ordnung, darf langsam wieder mit Sport begonnen werden.
Wie sind die Erfolgschancen beim Einpflanzen einer Bandscheibenprothese?
Die Erfolgsraten sind beim Bandscheibenersatz sehr hoch. Die meisten Patienten berichten, dass ihre Schmerzen deutlich abnehmen und sich die Beweglichkeit verbessert. Voraussetzung für ein gutes Gelingen sind jedoch die Expertise des Operateurs und die sorgfältige Patientenauswahl.
Trotz bester Vorbedingungen und gelungener Operation kann es jedoch nach dem Einsatz einer Bandscheibenprothese zu sogenannten Anschlussinstabilitäten kommen. Sie entstehen durch Überlastung der angrenzenden Wirbelsäulenelemente, die dadurch verstärkt verschleißen. Mit der Entwicklung moderner Prothesen konnte dieses Risiko reduziert werden. Studien deuten darauf hin, dass Anschlussinstabilitäten nach Bandscheibenersatz seltener auftreten als beim alternativen Eingriff - der Versteifungsoperation (Spondylodese).